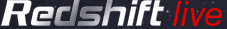Sternentstehungsregionen
Vista enthüllt das Geheimnis des Einhorns
 © ESO/J. Emerson/VISTA
|
Infraroter Blick auf die "stellare Babystube" im Sternbild Einhorn.
Das Visible and Infrared Survey Telescope for Astronomy (etwa “Astronomisches Durchmusterungsteleskop für das sichtbare und und infrarote Licht”, kurz VISTA) am Paranal-Observatorium der ESO in Nordchile kann den dunklen Vorhang aus kosmischem Staub dank seiner Fähigkeit, Infrarotlicht zu beobachten, durchdringen. Seine Bilder zeigen komplexe Strukturen, die durch die Wechselwirkung der intensiven Strahlung und der starken Teilchenströme („Sternwind“) der jungen Sterne mit dem Staub der Molekülwolke – ein kosmisches Netzwerk von Schlaufen, Bögen und Filamenten.
In den Worten von Jim Emerson von der Queen Mary University in London, dem Leiter des VISTA-Konsortiums: “Als ich das Bild zum ersten Mal sah, dachte ich nur: ‘Wow!’ Ich war begeistert, dass man die Staubbänder, die Monoceros R2 durchziehen, so deutlich sehen kann – außerdem, die „Jets“, die von den dicht umhüllten, jungen Sternen ausgehenden gebündelten Materieströme. Die VISTA-Bilder zeigen unglaublich viele interessante Details.“
Dank seines riesigen Gesichtsfelds, des großen Hauptspiegels und der hochempfindlichen Kamera ist VISTA ideal dafür geeignet, detailscharfe Aufnahmen von großen Himmelsfeldern wie der Region um Monoceros R2 zu machen, in denen auch leuchtschwache Objekte klar sichtbar werden. In einer Entfernung wie der von Monoceros R2 zeigt eine VISTA-Aufnahme eine Region mit einem Durchmesser von rund 80 Lichtjahren. Im Infraroten ist Staub zum größten Teil durchsichtig, so dass mit VISTA viele junge Sterne sichtbar werden, die im sichtbaren Licht unerkannt bleiben. Die massereichsten dieser Sterne sind weniger als zehn Millionen Jahre alt.
Das Bild ist eine Falschfarbendarstellung, die aus Einzelaufnahmen in drei verschiedenen Bereichen des nahinfraroten Spektralbereiches erstellt wurde. In Molekülwolken wie Monoceros R2 sind die Temperaturen so gering und die Dichten so hoch, dass Atome sich zu Molekülen zusammenfinden können, etwa zu molekularem Wasserstoff, die unter geeigneten Bedingungen im Nahinfraroten hell leuchten. Bei den meisten der in der VISTA-Aufnahme rosa und rötlich dargestellten Strukturen dürfte es sich um das Glimmen von molekularem Wasserstoff in den Materieströmen junger Sterne handeln.
Monoceros R2 hat einen dichteren Kernbereich mit einer Ausdehnung von weniger als zwei Lichtjahren, in dem sich massereiche Sterne zusammendrängen. Dort findet sich auch eine Ansammlung von hellen Infrarotlichtquellen, bei denen es sich überwiegend um neu geborene massereiche Sterne handelt, die noch immer von dichten Staubscheiben umgeben sind. Dieser Bereich befindet sich in der Bildmitte. Dort zeigt sich eine deutliche Konzentration von Sternen. Die auffälligen rötlichen Strukturen deuten auf Strahlung von molekularem Wasserstoff hin.
Die helle Wolke rechts von der Bildmitte ist NGC 2170, der auffälligste Reflexionsnebel in dieser Gegend. Im sichtbaren Licht wirken diese Nebel wie hellblaue Inseln in einem dunklen Ozean. Im Infrarotlicht dagegen kommen hektisch arbeitende Sternfabriken zum Vorschein, in denen Hunderte von massereichen Sternen entstehen. NGC 2170 ist mit kleinen Teleskopen noch gerade eben so zu erkennen und wurde 1784 von Wilhelm Herschel von England aus entdeckt.
Sterne bilden sich in einem Prozess, der typischerweise einige Millionen Jahre dauert, und der im Inneren von großen interstellaren Gas- und Staubwolken mit Ausdehnungen von Hunderten von Lichtjahren stattfindet. Da der Staub für sichtbares Licht undurchlässig ist, sind Infrarot- und Radiobeobachtungen für das Verständnis der allerersten Stadien der Sternentwicklung unverzichtbar. VISTA sammelt jede Nacht rund 300 Gigabyte an Daten und sucht den Südhimmel systematisch nach Regionen ab, die dann mit dem Very Large Telescope (VLT), dem Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) und in Zukunft mit dem European Extremely Large Telescope (E-ELT) genauer untersucht werden können.
Quelle: ESO