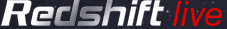Vesta - ein Asteroid in 3D
Ein Bild von Vesta mit seinen Rundungen und Einbuchtungen
 © NASA/JPL
|
Als Basis für die Animation des virtuellen Vesta erhielten die DLR-Wissenschaftler von der NASA "simulierte" Aufnahmen der Asteroiden-Oberfläche. Diese wiederum beruhten auf Aufnahmen des Hubble-Teleskops, das aus dem Weltall heraus aus großer Entfernung auf Vesta blickt. Mit diesem Material berechneten die Forscher des DLR-Instituts für Planetenforschung, welche Gestalt Vesta sehr wahrscheinlich haben wird.
Mit der Animation des virtuellen Asteroiden Vesta stellten die DLR-Wissenschaftler ihre Stereo-Software auf die Probe. "Wir haben diese Software zwar schon für Mond, Mars und Merkur eingesetzt, aber jede Mission hat nun einmal ihre Eigenheiten", sagt Roatsch. Für die virtuelle Übung erhielten die Forscher von Nick Mastrodemos vom Jet Propulsion Laboraty der NASA "simulierte" Aufnahmen der Asteroiden-Oberfläche. Diese wiederum beruhten auf Aufnahmen des Hubble-Teleskops, das aus dem Weltall heraus aus großer Entfernung auf Vesta blickt. Mit diesem Material berechneten Roatsch und sein Team, welche Gestalt Vesta sehr wahrscheinlich haben wird. Bis Vesta sich jedoch mit Rundungen und Einbuchtungen dreidimensional als Animation drehte, investierten die DLR-Wissenschaftler einige Wochen Arbeitszeit. Zeitgleich erarbeitete ein amerikanisches Team des Planetary Science Institute in Tuscon, Arizona, auf derselben Datenbasis – aber mit einer anderen Methode - ein dreidimensionales Modell von Vesta. Die Unterschiede zwischen den beiden entstandenen künstlichen Geländemodellen waren nur geringfügig. "Wir wissen jetzt, dass unsere Datenverarbeitung die erforderliche Genauigkeit leisten kann", betont Roatsch.
Weiterreise zum "nassen" Asteroiden Ceres
Allerdings: Den Planetenforschern ist bewusst, dass dies bisher nur Testläufe für die eigentliche Mission sind. "Wir werden erst dann wirklich wissen, wie Vesta aussieht, wenn Dawn am Asteroiden ankommt", sagt auch Carol Raymond, Dawn-Wissenschaftlerin am Jet Propulsion Laboratory der NASA. Etwa ein Jahr wird die Sonde um den Asteroiden kreisen und ihn dabei möglichst genau aufzeichnen und analysieren. Die DLR-Wissenschaftler hoffen dann, Vesta möglichst komplett kartografieren zu können. Damit ist die lange Reise der Sonde aber noch nicht beendet: Für sie geht es weiter zum Asteroiden Ceres, dem kompletten Gegensatz zu Vesta. Der größte bisher entdeckte Asteroid ist bis zu 450 Millionen Kilometer – und damit weiter als Vesta – von der Sonne entfernt und besteht unter seiner Kruste sehr wahrscheinlich aus Gas und zu 25 Prozent aus gefrorenem Wasser. Flüssigkeiten und Gase sind in dieser Entfernung von der Sonne nicht verdampft und ins Weltall entwichen. Welche Oberflächenstruktur der "nasse" Asteroid hat, ist noch unbekannt. Eventuell hat der Asteroid sogar eine dünne Atmosphärenschicht. Voraussichtlich im Februar 2015 wird "Dawn" in die Umlaufbahn von Ceres schwenken. "Mit der Dawn-Mission werden wir uns ein Bild davon machen, was in den ersten Millionen Jahren nach der Entstehung der Planeten geschah", sagt DLR-Planetenforscher Jaumann. "Wir fliegen sozusagen in die Morgendämmerung des Sonnensystems."Die Mission DAWN wird vom Jet Propulsion Laboratory (JPL) der amerikanischen Weltraumbehörde NASA geleitet. JPL ist eine Abteilung des California Institute of Technology in Pasadena. Die University of California in Los Angeles ist für den wissenschaftlichen Teil der Mission verantwortlich. Das Kamerasystem an Bord der Raumsonde wurde unter Leitung des Max-Planck-Instituts für Sonnensystemforschung in Katlenburg-Lindau in Zusammenarbeit mit dem Institut für Planetenforschung des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) in Berlin und dem Institut für Datentechnik und Kommunikationsnetze in Braunschweig entwickelt und gebaut. Das Kamera-Projekt wird finanziell von der Max-Planck-Gesellschaft, dem DLR und NASA/JPL unterstützt.
Quelle: DLR