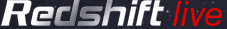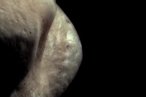Asteroiden - verschlossene Schatzkisten
Schwebende Steine
 © NASA/JPL; (arstist's image)
|
Kleopatra gehört mit einer Breite von über 200 km zu den größten Asteroiden des Hauptgürtels.
Ein Asteroid, auch Planetoid oder Kleinplanet genannt, ist in der Regel einen bis einige hundert Kilometer groß und sieht aus wie ein einfacher, unregelmäßig geformter Felsbrocken. Und hier beginnt bereits das Rätselraten um die Himmelskörper, die sich schlicht und unbedeutend geben wie überdimensionierte Kieselsteine in einem Flussbett: Sind sie wirklich solide Felsen? Warum kreisen sie dort, wo ein Planet sein sollte? Gab es einmal einen, der zerschellt ist – oder reichte es aufgrund verschiedener Anziehungskräfte nicht dazu, dass sich die dort herumfliegenden Steinbrocken zu einem Planeten zusammenballten?
C-Asteroiden: dunkle Farbe, reich an Silikaten und Carbonaten. Vermutlich gehören 75 Prozent aller Asteroiden dieser Klasse an.
S-Asteroiden: helle Farbe; Silikate und Metalle. Rund 15 Prozent aller Asteroiden.
M-Asteroiden: stark metallhaltig und ebenfalls von heller Farbe.
Daneben gibt es noch einige Untergruppen. Der im September von der Sonde Rosetta besuchte (2867) Steins beispielsweise ist einer der seltenen E-Asteroiden: Seine Oberfläche ist reich am Mineral Enstatit, wodurch er einen grauen Farbton besitzt und stark reflektiert.
Aus der Nähe, im Vorbeiflug, sind insgesamt erst neun einzelne Planetoide überhaupt fotografiert worden. Solange keine Sonde auf einem Asteroiden landet, lassen sich die Fragen nur indirekt beantworten. „Im Falle von Steins, den Rosetta im Vorbeiflug untersucht hat, sieht man auf den Fotos zum Beispiel einen Krater, der fast so groß ist wie der Asteroid selbst. Das kann heißen, dass Steins im Inneren ganz solide und robust ist. Der Einschlag, bei dem dieser Krater entstand, muss ein Schlag von hoher Energie gewesen sein. Wäre der Planetoid, wie manche Astronomen vermuten, nur eine lose Anhäufung von Felsbrocken, dann wäre er bei diesem Aufschlag praktisch explodiert.“ Das heißt allerdings nicht, dass die Theorie vom „rubble pile“, vom Asteroid als Geröllhaufen, endgültig vom Tisch ist, betont Ferri: „Ebenso wie Asteroiden unterschiedliche chemische Zusammensetzungen haben können, gibt es wahrscheinlich auch in dieser Hinsicht verschiedene Typen. Höchstwahrscheinlich bestehen einige Asteroiden aus einem Stück, andere sind rubble piles. Daher ist es umso wichtiger, mehrere zu untersuchen.“ Rosetta wird einen Anfang machen: nachdem sie den E-Asteroiden (2867) Steins schon hinter sich gelassen hat, fliegt sie im Juni 2010 an (21) Lutetia vorbei, die zur Klasse der M-Asteroiden gehört.
Carolin Konermann ist Technikjournalistin in Köln